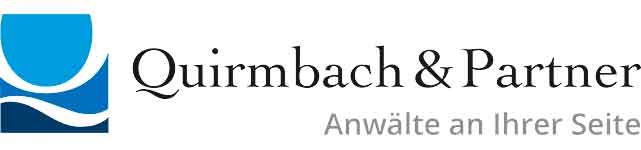Patientenanwalt: Ihr starker Partner in Arzthaftungsfällen
Die beste Unterstützung findet ein durch einen Behandlungsfehler geschädigter Patient bei einem spezialisierten Rechtsanwalt, am besten einem Fachanwalt für Medizinrecht, dessen Expertise im Arzthaftungsrecht für eine erstklassige Betreuung unerlässlich ist. Ähnlich wie bei der Wahl eines Facharztes für ein bestimmtes Gesundheitsproblem sollten Mandanten auch bei rechtlichen Fragen im Gesundheitsbereich auf das Spezialwissen eines auf Arzthaftung spezialisierten Patientenanwalts vertrauen. Wer Herzprobleme hat, geht schließlich auch nicht zum Augenarzt.
Dies gilt umso mehr, wenn es um schwerwiegende Folgen eines Behandlungsfehlers geht. Betroffene Patienten sollten daher unbedingt einen spezialisierten Patientenanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Patientenrechte beauftragen. Dieser verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, um den Geschädigten effektiv und sachgerecht zu vertreten.
Das Fachwissen des Anwalts für Patientenrechte
Die Spezialisierung des Anwalts auf Arzthaftungs- und Patientenrecht ermöglicht eine umfassende Analyse des Falles. Dazu werden die Behandlungsunterlagen gesichtet und ausgewertet. Hier ist der spezialisierte Fachanwalt im Vorteil, da die Kenntnisse im jeweiligen Fachgebiet eine umfassende Beurteilung des Falles ermöglichen.
Bei Quirmbach & Partner ist jeder Anwalt auf ein oder maximal zwei Fachgebiete spezialisiert und bildet sich regelmäßig fort. Bei größeren Fällen wie Geburtsschäden, Querschnittlähmung oder Schlaganfall arbeiten mehrere Patientenanwälte gemeinsam an einem Fall. Im Team kann die Beratung auf einem deutlich höheren Niveau angeboten werden. So profitieren die Mandanten nicht nur von der Erfahrung des einzelnen Anwalts, sondern von der eines ganzen Teams – ein Luxus, der sonst meist nur Versicherungen vorbehalten ist.
Erste Schritte: Behandlungsunterlagen und Eigeninitiative

Wichtig zu wissen: Idealerweise wird dieses Gedächtnisprotokoll so früh wie möglich begonnen, da Menschen dazu neigen, gerade belastende Erlebnisse schnell zu verdrängen. Auch Freunde oder Angehörige können gebeten werden, ihre Erlebnisse im Zusammenhang mit der Behandlung aufzuschreiben, denn nicht selten weicht das Erlebte von der Dokumentation der Behandler ab.
Die Behandlungsunterlagen und das Gedächtnisprotokoll des Patienten werden zu einem Sachverhalt zusammengefügt und der Patientenanwalt prüft, ob es tatsächlich zu Behandlungsfehlern gekommen ist. Dies ist die Grundlage für ein erfolgreiches weiteres Vorgehen.
Das medizinische Gutachten
Die Kombination von Behandlungsunterlagen und Gedächtnisprotokoll einerseits und die Trennung von Wichtigem und Unwichtigem andererseits macht die Arbeit eines guten Patientenanwaltes aus. Ist hier eine gute Basis gefunden, geht es darum, den schnellsten, kostengünstigsten und effektivsten Weg zu finden, um die Schmerzensgeld- und Schadenersatzansprüche für den Mandanten bestmöglich durchzusetzen. Um einen vermuteten Behandlungsfehler beweisen zu können, ist ein medizinisches Sachverständigengutachten von elementarer Bedeutung. Kaum ein Versicherer reguliert den Schaden, ohne dass ein Gutachten vorliegt. Auch Patientenanwälte sind auf eine fundierte medizinische Beurteilung angewiesen, um den Behandlungsfehler juristisch bewerten zu können.

- Gutachten der Schlichtungsstelle der zuständigen Landesärztekammer
- Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD), eingeholt über die gesetzliche Krankenversicherung
- das Privatgutachten.
Bei allen drei Gutachtenvarianten wird die medizinische Behandlung aus medizinischer Sicht begutachtet und schriftlich bewertet. Die rechtliche Bewertung und damit die Schadensregulierung und Bezifferung des Schadens ist noch nicht erfolgt.
Negatives Gutachten – Was nun?
Die Meinung eines Gutachters kann richtungsweisend sein, muss aber nicht immer der Meinung anderer Gutachter entsprechen. Auch wenn ein negatives Gutachten entmutigt: Ein guter Patientenanwalt kann ein überzeugendes Gutachten von einem nicht überzeugenden unterscheiden. Natürlich ist ein Fachanwalt für Medizinrecht, der sich z.B. auf das Geburtsschadensrecht spezialisiert hat, kein Gynäkologe oder Neonatologe. Eine Begutachtung sollte daher immer durch einen Facharzt erfolgen. Ein guter Patientenanwalt kann aber auf seine langjährige Erfahrung und sein Spezialwissen zurückgreifen. Er weiß, dass Gutachter bestimmte Punkte unterschiedlich beurteilen können. Dieses Wissen und diese Erfahrung sind auch entscheidend für die Frage, ob es sinnvoll ist, ein weiteres Gutachten einzuholen, das ihm eine sehr realistische Einschätzung der Erfolgsaussichten ermöglicht.
Strafverfahren in Arzthaftungsfällen vermeiden
Geschädigte Patienten äußern häufig den Wunsch, dass der für den Gesundheitsschaden verantwortliche Arzt verurteilt wird. Das ist menschlich verständlich, aber es ist ein großer Fehler, bei Streitigkeiten um Schmerzensgeld und Schadenersatz wegen eines Behandlungsfehlers gleichzeitig ein Strafverfahren gegen den Arzt einzuleiten. Dies kann den zivilrechtlichen Prozess behindern, wenn die Patientenakte beschlagnahmt wird und auch zu Gutachten führen, die nicht verwertbar sind. Der Schwerpunkt der Staatsanwaltschaft liegt auf der Verurteilung des Arztes und nicht auf der Entschädigung des Patienten.
Die Bezifferung: Kein Geld verschenken

Aufgabe eines guten Patientenanwalts ist es daher, neben einer guten Bezifferung des Schmerzensgeldes auch an alle weiteren relevanten Schadenspositionen zu denken, die das Schmerzensgeld in der Höhe durchaus übersteigen können. Hier muss ein Anwalt umfassend aufklären und – soweit erforderlich und sinnvoll – ergänzend weitere Sachverständige hinzuziehen, die eine gezielte Bedarfsanalyse vornehmen können.
Die Schadensregulierung im Fokus
Grundsätzliches Ziel sollte es sein, in Regulierungsgesprächen mit der gegnerischen Versicherung eine außergerichtliche Lösung zu erreichen, nicht zuletzt, um dem Mandanten die Risiken und Belastungen eines Prozesses zu ersparen. Führen die Verhandlungen mit der gegnerischen Versicherung jedoch zu keinem Ergebnis, ist der Gang vor Gericht unausweichlich.
Ein Anwalt für Patientenrechte weiß, dass Ansprüche nicht selten gerichtlich durchgesetzt werden müssen. Es ist daher von größter Wichtigkeit, dass von Anfang an klar kommuniziert wird, dass der Anwalt seinen Mandanten vor Gericht uneingeschränkt unterstützt. Der einmal eingeschlagene Weg sollte konsequent zu Ende gegangen werden. Kommt der Anwalt jedoch nach sorgfältiger Analyse zu dem Schluss, dass die Erfolgsaussichten gering sind, kann es im Einzelfall gerechtfertigt sein, von einer Klage abzusehen. Diese Entscheidung bedarf jedoch einer sorgfältigen Abwägung.
Fazit
Niemand ist machtlos. Durch eine gründliche Aufarbeitung und das Führen eines Gedächtnisprotokolls kann auch der geschädigte Patient einiges zur Verbesserung seiner Situation beitragen. Mit dem richtigen Partner an seiner Seite kann er auf fundierte Erfahrungen und Spezialwissen zurückgreifen, um letztlich dem Versicherer die Stirn zu bieten. Der Geschädigte stärkt seine Position also nicht nur durch eigenes Handeln, sondern auch durch die Wahl des richtigen Patientenrechtsanwalts. Im Einzelfall ist es entscheidend, auf einen hohen Spezialisierungsgrad, Erfahrung und gegebenenfalls gute Referenzen oder Auszeichnungen Wert zu legen. Es macht eben einen Unterschied, ob der Augenarzt am Herzen operiert.
Rechtsanwalt Alexander Rüdiger, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Lehrbeauftragter der Universität Siegen