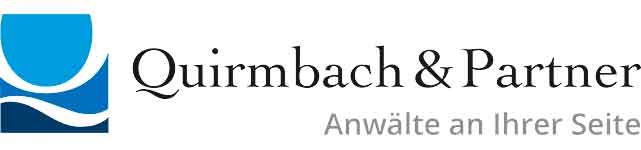Die Rolle von Strafrecht und Zivilrecht nach einem Unfall oder Behandlungsfehler
„Ich möchte, dass derjenige, der mir das angetan hat, verklagt wird und seine gerechte Strafe erhält“ ist ein Satz, der uns in der anwaltlichen Praxis sehr häufig begegnet. Gemeint ist der Unfallverursacher oder der Arzt, der dem Mandanten einen schweren körperlichen Schaden zugefügt hat. Meistens raten wir von einem solchen Schritt ab. Denn nach einem Strafprozess mag der Geschädigte zwar die Genugtuung haben, dass der Täter für seine Tat bestraft wurde, aber das eigentlich Wichtige ist noch offen: die finanzielle Wiedergutmachung, der Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadensersatz, der sich zivilrechtlich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ergibt.
Was geschieht im Strafverfahren?
Im Strafverfahren werden Verstöße gegen das Strafgesetzbuch (StGB) nach den Regeln der Strafprozessordnung (StPO) verhandelt. Hat die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen Anklage erhoben, entscheidet ein Gericht nach Anhörung beider Parteien und ihrer Zeugen, ob der Angeklagte schuldig und damit zu verurteilen ist. Ankläger ist immer die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch einen Staatsanwalt. Der Angeklagte wird in der Regel durch einen Verteidiger vertreten. Es gibt Straftaten, die besonders schwer wiegen, so dass das öffentliche Interesse an einer Bestrafung besonders groß ist. In diesen Fällen wird die Staatsanwaltschaft nach dem Gesetz auch ohne Antrag tätig. Bei Bagatelldelikten bleibt es dem Verletzten überlassen, ob er einen Strafantrag stellt oder nicht. Die Staatsanwaltschaft wird nur tätig, wenn ein form- und fristgerechter Strafantrag gestellt wird.
Kommt es zu einer Verurteilung, erhält der Geschädigte die Genugtuung, dass der Täter für seine Tat bestraft wurde. Der Strafrichter stellt jedoch nicht die finanzielle Wiedergutmachung in den Vordergrund, sondern urteilt über die individuelle Schuld des Täters.
Das Zivilverfahren
Der Geschädigte ist in erster Linie daran interessiert, dass sein Schaden angemessen ersetzt wird. Erkennt der Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherung den Anspruch nicht oder nicht in voller Höhe an, ist der Gang zum Gericht unausweichlich. Da das Recht auf Schadenersatz und Schmerzensgeld zum Zivilrecht gehört, findet diese Auseinandersetzung vor einem Zivilgericht statt.
Solange jedoch ein Strafverfahren nicht abgeschlossen ist, weigert sich die hinter dem Unfallverursacher bzw. Arzt stehende Haftpflichtversicherung, den Schaden zu regulieren. Außerdem kann ein Zivilverfahren nicht beginnen, bevor das Strafverfahren abgeschlossen ist.
Wird der Schädiger im Strafverfahren freigesprochen, führt dies zwar nicht automatisch zum Scheitern der Schadensersatzverhandlungen, erschwert aber die Durchsetzung erheblich. Natürlich will kein Arzt seinem Patienten schaden, sondern er tut sein Bestes, um ihn zu heilen. Und doch passieren Fehler – fast immer fahrlässig. Weder Staatsanwälte noch Richter verfolgen Ärzte gerne. Auch deshalb enden Strafverfahren gegen Ärzte oft ohne Verurteilung.
Außergerichtliche Einigung
Aus all diesen Gründen raten wir grundsätzlich von einer Strafanzeige ab, es sei denn, es ist von einem vorsätzlichen Fehlverhalten auszugehen. Für uns steht der geschädigte Mandant an erster Stelle. Er benötigt in den meisten Fällen dringend Geld, um sein Leben nach dem Schadensereignis zumindest in finanzieller Hinsicht so gestalten zu können, wie es ohne das Schadensereignis möglich gewesen wäre.
Da sich zivilrechtliche Auseinandersetzungen oft über Jahre hinziehen, ist es für den Geschädigten nicht hilfreich, den Zeitraum bis zur Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld durch eine Strafanzeige noch zu verlängern. Grundsätzlich sollte jede gerichtliche Auseinandersetzung vermieden und eine möglichst rasche außergerichtliche Einigung angestrebt werden, nicht zuletzt um dem Geschädigten die mit einem Prozess verbundenen Risiken und Belastungen zu ersparen.
Thomas Gfrörer, Rechtsanwalt und Partner