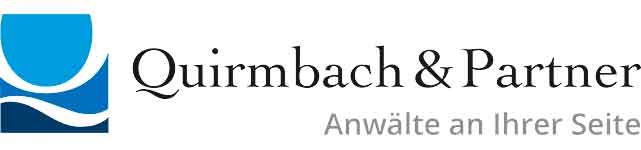Mitursächlichkeit im Arzthaftungsrecht
Voraussetzung für die erfolgreiche Geltendmachung von Ansprüchen wegen eines Behandlungsfehlers ist zum einen, dass ein Behandlungsfehler gutachterlich festgestellt wurde. Zum anderen muss der Behandlungsfehler zu einem Gesundheitsschaden geführt haben. Steht beides fest, also sowohl der Behandlungsfehler als auch der Gesundheitsschaden, und lässt sich darüber hinaus die Kausalität zwischen beiden nachweisen, haftet der behandelnde Arzt bzw. die Klinik.
Steht ein Behandlungsfehler fest, aber kein kausal daraus resultierender Schaden, kann ein Schadenersatzanspruch nicht durchgesetzt werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Arzt zwar nicht leitliniengerecht gehandelt hat, der Gesundheitsschaden aber dennoch eingetreten wäre, d.h. auch bei ordnungsgemäßem Handeln des Arztes.
Haftung auch bei Mitverursachung des Schadens durch Behandlungsfehler
Nicht immer lässt sich eindeutig feststellen, ob ein Behandlungsfehler oder eine andere Ursache für einen Schaden verantwortlich ist. Leidet der Patient beispielsweise bereits vor der ärztlichen Behandlung an einer bestimmten Krankheit und unterläuft dem Arzt ein Behandlungsfehler, der einen Gesundheitsschaden verursacht, der ohne die Vorerkrankung nicht so gravierend ausgefallen wäre, so genügt nach der Rechtsprechung die Mitursächlichkeit des Behandlungsfehlers. Es genügt also, dass der Schaden durch den Behandlungsfehler mitverursacht wurde.
Ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm (Urteil vom 21.11.2014, Az.: 26 U 80/13) stellt in diesem Zusammenhang klar, dass eine Mitursächlichkeit des Behandlungsfehlers die Haftung für den gesamten Schaden auch dann begründet, wenn sich ein abgrenzbarer Teil des Schadens, der auf diese Ursache zurückzuführen ist, nicht genau bestimmen lässt.
In dem zugrunde liegenden Fall wurde ein Dünndarmverschluss zu spät erkannt und behandelt. Ein Teil des Darms starb ab und die Klägerin leidet nun an einem sogenannten Kurzdarmsyndrom, so dass ihr Dünndarm fette und fettlösliche Stoffe nicht mehr richtig aufnehmen kann. Auch diese Folge führte das Gericht auf den Behandlungsfehler zurück, obwohl auch andere Ursachen denkbar seien.
Mit diesem Urteil unterstreicht das OLG Hamm erneut die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach der Schädiger einen Gesunden nicht schädigen darf, der Arzt also keinen Anspruch darauf hat, so gestellt zu werden, als sei der Patient vor der Behandlung völlig gesund gewesen.
Der Schädiger, hier der Arzt, haftet also auch dann, wenn der Schaden nur deshalb eingetreten ist, weil der Betroffene aufgrund seiner besonderen Konstitution für die eingetretenen Beschwerden besonders anfällig war.
Ines Gläser, Fachanwältin für Medizinrecht