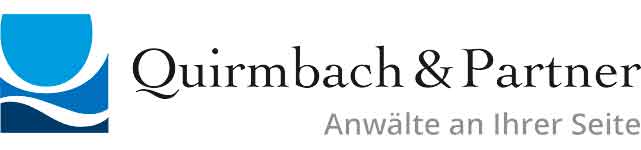Ärztliche Schweigepflicht – Umfang und Grenzen
Eines der Themen der 15. Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im Deutschen Anwaltverein war Umfang und Grenzen der ärztlichen Schweigepflicht. Konkreter Anlass der Diskussion war der Germanwings-Absturz, nach dem Stimmen laut wurden, die meinten, die ärztliche Schweigepflicht gehe unter Umständen zu weit.
Umfang der ärztlichen Schweigepflicht
Die ärztliche Schweigepflicht ist ein hohes Gut und dient dem Schutz des Patienten. Es gilt der Grundsatz, dass ein Arzt über das, was ihm der Patient anvertraut, zu schweigen hat. Verstößt er gegen diesen Grundsatz, macht er sich gemäß § 203 Strafgesetzbuch strafbar bzw. verstößt er gegen § 9 der (Muster-)Berufsordnung der Ärzte. Allerdings findet man in diesen Regelungen keine eindeutige Antwort darauf, wann die Schweigepflicht gebrochen werden darf oder gar muss.
Für das Oberlandesgericht Karlsruhe (Urteil v. 11.08.2006, 14 U 45/04) geht die Geheimhaltungspflicht sogar so weit, dass ein Arzt weder den Namen des Patienten angeben darf noch, dass eine bestimmte Person überhaupt Patient bei ihm ist. Die ärztliche Schweigepflicht ist grundsätzlich auch gegenüber anderen, nicht unmittelbar an der Behandlung beteiligten Ärzten zu beachten. Eine Geheimhaltungspflicht des Arztes besteht außerdem gegenüber den Angehörigen des Patienten und auch gegenüber den Angehörigen des Arztes. Die Schweigepflicht gilt über den Tod des Patienten hinaus, was einem sehr weitreichenden Schutz gleichkommt.
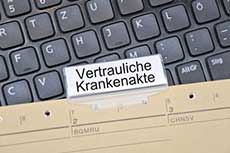
Bildquelle: fotolia
Grenzen der ärztlichen Schweigepflicht
Die Schweigepflicht hat allerdings auch ihre Grenzen: Ist die Allgemeinheit konkret gefährdet, darf bzw. muss der Arzt sich an die zuständigen Stellen wie beispielsweise Polizei, spezielle Behörden (Gesundheitsamt etc.) oder die gefährdete Person selbst wenden, um die konkreten Gefahr für Leib oder Leben abzuwenden (sog. Notstand, § 34 Strafgesetzbuch).
Wann die Schweigepflicht gebrochen werden darf bzw. muss oder ob sie das höherwertige Gut ist, muss immer im Einzelfall geklärt werden. Selbst beim Abwägungsprozess darf der Arzt seine Pflicht nicht vernachlässigen und muss sich unter Umständen rechtlichen Rat einholen und dabei den Sachverhalt anonym schildern.
Die sehr lebhaft geführte Diskussion im Rahmen der Tagung hatte im Großen und Ganzen zum Ergebnis, dass die bisherigen gesetzlichen Regelungen ausreichen und der Patient in jedem Falle schutzwürdig ist.
Ärztliche Schweigepflicht für sensible Berufsgruppen
Berufspiloten werden alle 6 bis 12 Monate flugmedizinisch von speziell dafür zugelassenen Ärzten untersucht. Eine Übermittlung weitergehender medizinischer Daten bzw. der dem Arzt anvertrauten Informationen darf, wie bei der allgemeinen ärztlichen Behandlung, nur zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder bei einer drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit erfolgen.
Die heutige Gesetzeslage hat den behandelnden Ärzten des Co-Piloten jede Möglichkeit gegeben, bei konkretem Verdacht die Schweigepflicht zu brechen. Ein solcher Verdacht lag offensichtlich nicht vor.
Aus einem Einzelfall könne, unabhängig davon, wie tragisch er sei, keine für alle Patienten und Ärzte so weitreichende und nachteilige Konsequenz gezogen werden, so die Mehrzahl der Diskussionsbeiträge. Zudem könne keine Regelung der Welt eine Person davon abhalten, sich so zu verhalten, wie der Co-Pilot es getan hat.
Würde man bei jeder psychischen Erkrankung eines Angestellten, der in einem Beruf arbeitet, der potentielle Gefahren für andere birgt, die Schweigepflicht aufheben, würde das vertrauensvolle Gespräch zwischen Arzt und Patient nicht mehr stattfinden. Gerade bei psychischen Erkrankungen ist das Vertrauen zwischen Arzt und Patient elementare Grundlage der Behandlung. Kein Patient, erst recht kein Pilot, würde seine psychischen Probleme und seien sie noch so gering, offenlegen, wenn er befürchten muss, dass er dadurch seine Flugtauglichkeit verlieren könnte. Ein offenes Gespräch würde nicht mehr stattfinden und eine vielleicht gut behandelbare psychische Erkrankung bliebe im Verborgenen.