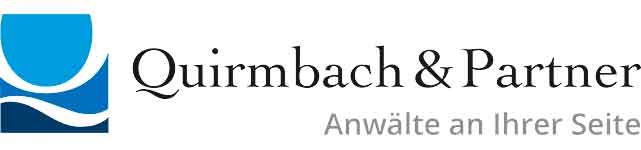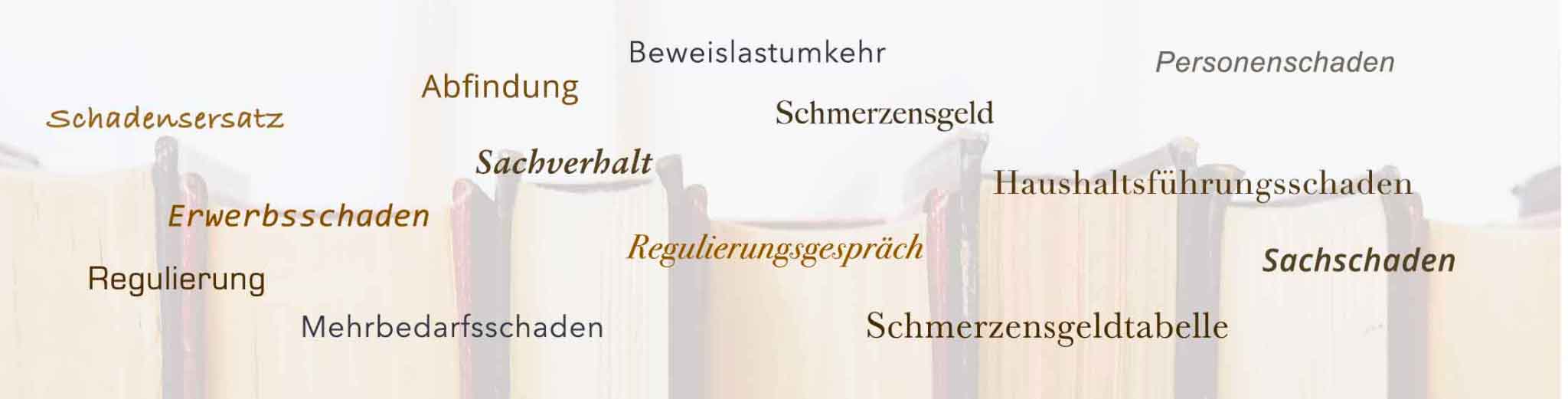Personenschaden
Das Spektrum sogenannter Personenschäden reicht von kleineren über schwere und schwerste Verletzungen bis hin zu Invalidität und Tod. Geschädigte haben – je nach Schwere der Verletzung – Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld.
Schmerzensgeld
Das Schmerzensgeld ist die Entschädigung für die Lebensqualität und Lebensfreude, die ihnen nach Unfällen oder Behandlungsfehlern verloren gegangen sind. In der Regel handelt es sich um einen Einmalbetrag; in schweren Fällen kann aber zusätzlich eine sogenannte Schmerzensgeldrente vereinbart werden.
Wichtig für Sie: Sobald die Haftung feststeht und der Schaden abschätzbar ist, muss die die Gegenseite Abschlagszahlungen leisten. Die wichtigsten Faktoren bei der Berechnung des Schmerzensgeldes sind
- die Schwere der Verletzung
- die Dauer der Behandlung und des stationären Klinikaufenthalts
- die Intensität der Schmerzen (zum Beispiel bei Verbrennungen)
- das Alter des Verletzen
- in ganz besonderem Maße die weiteren Folgen (von dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen bis hin zu psychischen Problemen wie Depressionen).
Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit eine sogenannte „M.d.E.“ (Minderung der Erwerbsfähigkeit) vorliegt.
Eines der bislang höchsten in Deutschland gezahlten Schmerzensgelder (rund 700.000 Euro) haben wir für einen Mandanten erstritten, der durch einen Behandlungsfehler von Geburt an schwerstbehindert ist. Wenn Sie einen Anspruch auf Schmerzensgeld vermuten, sollten Sie vor allem auf folgende Punkte achten:
- Dokumentieren Sie die Verletzung und deren Verlauf durch Fotografien.
- Notieren Sie Name und Anschrift des Verursachers, sowie möglicher Zeugen.
- Ziehen Sie bei Unfällen mit Personenschäden die Polizei hinzu.
- Führen Sie täglich ein Gedächtnisprotokoll. Halten Sie hierbei alle unfallbedingten Sachverhalte und Ereignisse fest und notieren Sie auch Intensität und Dauer der Schmerzen.
- Sammeln Sie alle Belege.
Sicher: Kein noch so hohes Schmerzensgeld bringt Ihnen Ihre Gesundheit zurück. Aber es verbessert Ihre wirtschaftliche Situation meist erheblich. Und es ist wissenschaftlich bewiesen und auch leicht nachvollziehbar, dass dies ganz entscheidend zur Genesung beiträgt.
» mehr über Schmerzensgeld erfahren
Schmerzensgeldtabellen
Schmerzensgeldtabellen zeigen, welche Beträge typischerweise für bestimmte Verletzungen gezahlt werden. Allerdings sind sie allenfalls eine Orientierungshilfe, weil sie die besonderen Umstände jedes einzelnen Falls nicht berücksichtigen. Dazu zählt neben der Schwere der Verletzung und ihren körperlichen Folgen auch die psychische Seite: Immer wieder leiden Opfer unter schweren Ängsten, Depressionen und sozialer Isolierung
In der Praxis unterscheiden sich die Schmerzensgeldbeträge für vergleichbare Verletzungen deshalb deutlich. Während ein Richter 50.000 Euro für adäquat hält, kann ein anderer in einem ähnlich gelagerten Fall zu dem Schluss kommen, dass 100.000 Euro angemessen sind.
Auswahlkriterien für die Aufnahme in Schmerzensgeldtabellen
Hinzu kommt: Die Auswahlkriterien für die Aufnahme einer Entscheidung in die Schmerzensgeldtabellen sind willkürlich. Sie haben weder einen wissenschaftlichen Hintergrund noch eine statistische Grundlage. So werden lediglich Entscheidungen berücksichtigt, die dem Herausgeber der Tabellen mitgeteilt werden – und einige davon sind schlicht und ergreifend falsch. Zudem tauchen außergerichtliche Einigungen und gerichtliche Vergleiche gar nicht in den Tabellen auf.
Das betrifft einen aktuellen Fall aus unserer Praxis: Nachdem bei Geburtsschäden über viele Jahre hinweg ein Schmerzensgeld von 500.000 Euro als absolute Obergrenze galt, haben wir jüngst für ein seit der Geburt schwerstgeschädigtes Kind ein Schmerzensgeld in Höhe von 700.000 Euro erstritten. Da es sich um einen Vergleich beim Oberlandesgericht Frankfurt handelte, wird der Betrag in den Schmerzensgeldtabellen jedoch nicht berücksichtigt werden.
Dass die in Vergleichen ausgehandelten Beträge in der Regel deutlich höher sind, als es die Schmerzensgeldtabellen suggerieren, bedeutet für Verletzte: Sie sollten sich auf keinen Fall voreilig mit den Beträgen zufriedengeben, die dort genannt werden.
» mehr über Schmerzensgeldtabellen erfahren
Sachverhalt
Mit dem „Sachverhalt“ meinen wir alle Tatsachen und Umstände, die dem Schadensereignis zugrunde liegen. In Arzthaftungsfällen gehören dazu beispielsweise der Grund der Behandlung, deren Verlauf sowie die Fehler, die den Ärzten vorgeworfen werden. In Unfallsachen meinen wir damit das Unfallgeschehen und dessen Folgen.
In beiden Rechtsgebieten gilt der Grundsatz: Je genauer der Hergang des Schadens und dessen Folgen dokumentiert sind, desto größer ist die Chance auf einen angemessenen Schadenersatz!
Haushaltsführungsschaden
Wenn Sie nach einem Unfall oder Behandlungsfehler Unterstützung im Haushalt brauchen, sprechen Juristen von einem „Haushaltsführungsschaden“. Wichtig: Anspruch auf Entschädigung haben Sie auch, wenn Sie vieles noch selbst erledigen können, sich dafür aber übermäßig anstrengen müssen.
Zu den Arbeiten im Haushalt gehören neben klassischen Tätigkeiten wie Kochen, Putzen und Waschen auch der Einkauf, die Kinderversorgung, die Betreuung kranker Angehöriger, die Pflege von Pflanzen und Tieren, die Gartenarbeit sowie die Reparaturen, die Sie selbst ausführen.
Verdienstausfall/Erwerbsschaden
Wer wegen einer Verletzung oder Erkrankung nicht mehr arbeiten kann, verdient in der Regel auch kein Geld mehr.
Für diesen Verdienstausfall steht Opfern von Unfällen oder Behandlungsfehlern eine Entschädigung zu; es gilt der Grundsatz: Ihnen darf unterm Strich nicht weniger zur Verfügung stehen als vorher. Die gegnerische Versicherung muss Geschädigte also so stellen, als würden sie weiter ihren bisherigen Nettolohn einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld erhalten bzw. ihren bisherigen Gewinn erzielen.
Zudem haben sie Anspruch auf Entschädigung für Lohn- bzw. Gewinnsteigerungen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eingetreten wären. Dazu wird prognostiziert, wie sich ihr Einkommen bzw. Ihr Gewinn unter normalen Umständen entwickelt hätte. Renten, die die Rentenversicherung oder eine Berufsgenossenschaft zahlen, werden angerechnet.
Mehrbedarfsschaden – vermehrte Bedürfnisse
Alle zusätzlichen Kosten, die Sie durch die veränderte Situation tragen müssen, können als „Mehrbedarfsschaden“ geltend gemacht werden. In erster Linie betrifft dies Pflege- und Betreuungskosten. Dabei sind aber nicht nur Ausgaben für professionelle Pflegekräfte zu berücksichtigen: Auch die Zeit, die Familienmitglieder, Nachbarn oder Freunde aufwenden, muss entschädigt werden – und zwar mit zehn bis zwölf Euro pro Stunde. Leistungen der Krankenversicherung oder Berufsgenossenschaft werden dabei angerechnet.
Neben Pflege- und Betreuungskosten gehören auch notwendige Umbaukosten und zahlreiche weitere Ausgaben zum „Mehrbedarf“ bzw. den vermehrten Bedürfnissen; die Palette reicht vom Kaufpreis eines Rollstuhls bis hin zu den Kosten spezieller Diäten. Auch hier gilt der Grundsatz: Je besser die Dokumentation, desto einfacher ist die Regulierung.
Sachschaden
Das Prinzip ist klar: Alles, was bei einem Unfall beschädigt wurde oder verloren gegangen sind, muss Ihnen als „Sachschaden“ ersetzt werden. Das betrifft in der Regel Ihr Fahrzeug und Ihre Kleidung, aber immer wieder auch Uhren, Schmuck und andere Gegenstände.
Beweislastumkehr
Nicht der Patient, sondern der Arzt muss beweisen, dass auch bei ordnungsgemäßer Behandlung der gleiche Schaden eingetreten wäre.
Die Beweislastumkehr tritt ein
- wenn z.B. eine dokumentationspflichtige Maßnahme nicht dokumentiert wurde
- sich ein vollbeherrschbares Risiko verwirklicht. Hierzu zählen beispielsweise die typischen Fälle, in denen OP-Werkzeug im weitesten Sinne im Operationsgebiet „vergessen“ wurde und
- wenn ein grober Behandlungsfehler vorliegt. Dazu der BGH: „Ein eindeutiger Verstoß gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gegen gesicherte medizinische Erkenntnisse, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf“.
» mehr zu Beweislast und Beweislastumkehr
Regulierung/Regulierungsgespräch/Regulierer
Wir sprechen häufig von der „Regulierung“. Das ist der Oberbegriff für sämtliche Bemühungen um Schadensersatz und Schmerzensgeld. Sobald wir den Schaden berechnet haben und die Gegenseite die Haftung bestätigt hat, führen wir „Regulierungsgespräche“ mit einem „Regulierer“, also einem von der gegnerischen Haftpflichtversicherung beauftragten Mitarbeiter.
Abfindung
Eine Abfindung ist eine Einmalzahlung, mit der sämtliche Schäden aus der Vergangenheit und für die Zukunft abgegolten sind. Eine Abfindungslösung ist immer dann sinnvoll, wenn der Schaden feststeht und die Ärzte in Zukunft keine außergewöhnlichen Risiken sehen. Mit einer entsprechenden Vertragsklausel lassen sich allerdings auch verbleibende Risiken – etwa die Gefahr einer erneuten Operation oder einer Arbeitsunfähigkeit – sehr gut abfangen.
Der Vorteil gegenüber einer Rentenlösung ist, dass Sie sich nicht mehr mit der Versicherung auseinandersetzen müssen. Wertmäßig entspricht der Abfindungsbetrag exakt den abgezinsten Renten bis zu Ihrem Berufs- bzw. statistischen Lebensende.