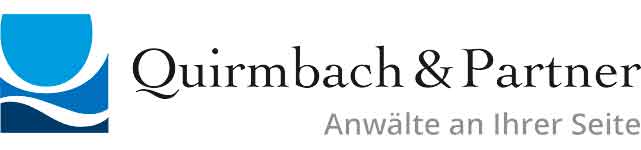Entwicklung und Herausforderungen der modernen Geburtshilfe
Es ist ein Thema, mit dem sich viele schon lange beschäftigen, das aber gerade im Zeitalter der Maximierung und Optimierung wieder an Aktualität gewonnen hat. Schon vor einigen Jahren ging die Süddeutsche Zeitung der Frage nach, was es für die Menschen bedeutet, wenn kleinere Kliniken schließen.
Allein die Statistik spricht Bände: Seit 2009 wurden z.B. in Rheinland-Pfalz 44 Prozent der Kliniken mit Geburtshilfe geschlossen. In absoluten Zahlen heißt das: 23 von 52 Krankenhäusern haben innerhalb von 14 Jahren ihre Geburtshilfe geschlossen. Die Frage ist berechtigt: Ist das gut oder schlecht?
Die positive Seite der Kreißsaalschließungen
Ein Artikel mit dem Titel „Eine schöne Geburt? Ist nicht das Wichtigste“ argumentiert, dass der bundesweite Trend zur Schließung von Geburtskliniken nicht zwangsläufig negativ zu bewerten ist. Diese Entwicklung kann als Chance gesehen werden, die Qualität und die Arbeitszufriedenheit in den verbleibenden Kreißsälen zu verbessern. Die Konzentration der Geburtshilfe auf weniger, aber besser ausgestattete Kliniken kommt letztlich den Schwangeren und werdenden Eltern zugute. Die Zahl der Notfälle wird dadurch zwar nicht reduziert, aber die Chancen auf ein gutes Ergebnis für Mutter und Kind steigen deutlich. Eine solche Spezialisierung würde auch die Arbeitsbedingungen und die Praxiserfahrung des Personals verbessern. Ein Vergleich mit Ländern wie Norwegen, Schweden und England, in denen die Geburtshilfe zentralisiert ist, stützt diese These.
Versorgungslücken auf dem Land
Ein weiterer Artikel „Wie das Leben beginnt, geht uns alle an“ beleuchtet die Schattenseiten von Versorgungslücken in ländlichen Regionen. In einigen Regionen, etwa auf den Nordseeinseln oder in ländlichen Gebieten Bayerns, wurden trotz steigender Geburtenraten zahlreiche Kliniken geschlossen. Damit sich die Qualität des ärztlichen und nichtärztlichen Personals (insbesondere der Hebammen) überhaupt auswirkt, muss die Schwangere natürlich erst einmal zum Arzt kommen können. Wenn die nächste spezialisierte Klinik Stunden entfernt ist, dann nützt auch die höchste Qualität dieser Klinik nichts. Die Qualität der Geburtshilfe in Deutschland leidet.
Komplexität kindlicher Geburtsschäden

Was sagt der Medizinrechtler?
Glücklicherweise verläuft die überwiegende Mehrzahl der Geburten erfolgreich. Das nützt aber den 2 von 100 Eltern oder Frauen nichts, bei denen es anders kommt. Aus juristischer Sicht ist eine Vollversorgung wünschenswert, aber nicht realistisch. Bei Risikoschwangerschaften sollte es keine Frage sein, in welcher Klinik die Geburt stattfindet. Hier sollte im Vorfeld eine umfassende Aufklärung durch den Gynäkologen erfolgen, damit die Eltern gar nicht erst auf die Idee kommen, in ein Krankenhaus zu gehen, das nicht ausreichend versorgt ist. Hier sollte schnell gehandelt werden und die Schwangere in eine Universitätsklinik oder zumindest in ein Perinatalzentrum eingewiesen oder notfalls verlegt werden.
Warum Telemedizin hier helfen kann
Ländliche Gebiete und kleine Kliniken stehen häufig vor der Herausforderung, dass die medizinische Versorgung durch begrenzte Ressourcen und Expertise erschwert wird. Telemedizin, eine Form der medizinischen Versorgung, die moderne Kommunikationstechnologien nutzt, um Patienten und Ärzte über Entfernungen hinweg zu verbinden, bietet hier innovative Lösungen.
Durch Telemedizin können Patienten in kleineren Kliniken von Fachwissen und Spezialbehandlungen profitieren, die sonst nur in größeren, zentralisierten Krankenhäusern verfügbar sind. Beispielsweise können durch telemedizinische Konsultationen Experten aus entfernten medizinischen Zentren Diagnosen unterstützen und Behandlungspläne mit den Ärzten vor Ort austauschen. Dies verbessert nicht nur die Qualität der Patientenversorgung, sondern erspart den Patienten auch lange Anfahrtswege für Spezialbehandlungen.
Risikominimierung und Verbesserung der Geburtshilfe durch Telemedizin
Der Einsatz von Telemedizin in kleinen Kliniken kann auch die Patientenüberwachung effizienter machen. Technologien wie das Telemonitoring ermöglichen die kontinuierliche Erfassung und Analyse von Patientendaten, so dass Ärzte schnell auf Veränderungen im Gesundheitszustand der Patienten reagieren können.
Was bleibt, ist die Unsicherheit und letztlich die fehlende Möglichkeit, selbst als Spezialist zu reagieren. Auch wenn geschultes Personal sogar per Hubschrauber einfliegen kann, zählt in der Geburtshilfe oft jede Minute. Ein Sauerstoffmangel tritt meist innerhalb weniger Minuten auf und kann zu bleibenden Schäden führen. In unserer täglichen Praxis erleben wir immer wieder, dass sich Zentren überschätzen und die Geburt übernehmen, obwohl sie Mutter und Kind hätten verlegen müssen. Den Schaden haben dann der Patient und seine Eltern.
Nicht in allen Fällen ist dies vermeidbar, aber in vielen Situationen hätte der Schaden geringer ausfallen können.
Rechtsanwalt Alexander Rüdiger, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Lehrbeauftragter der Universität Siegen